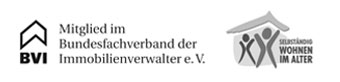Die Bundesregierung hat sich in einer Antwort auf eine Kleine Anfrage zum Stand der kommunalen Wärmeplanung geäußert. Sie unterstreicht dabei, dass das Pariser Klimaabkommen in Deutschland den Rang von Bundesrecht besitzt und somit eine verbindliche Grundlage für die Wärmewende darstellt. Die Regierung hält an diesem Rahmen fest und sieht die kommunale Wärmeplanung als zentrales Instrument zur Erreichung der Klimaziele.
Eine zentrale Kritik kommt aus der Kommunalumfrage, auf die sich die Anfrage stützt. Lediglich sieben Prozent der befragten Kommunen stuften die gesetzlichen Anforderungen als „machbar“ ein. Deutlich mehr, rund 49 Prozent, bezeichneten sie als „ambitioniert“, während 44 Prozent sie für „zeit- und ressourcentechnisch nicht umsetzbar“ hielten. Die Bundesregierung verweist jedoch darauf, dass die Befragung im Spätsommer 2023 stattfand – zu einem Zeitpunkt, als das Wärmeplanungsgesetz noch nicht in Kraft war.
Nach Einschätzung der Bundesregierung ist die Bewertung „ambitioniert“ nicht gleichbedeutend mit Ablehnung, sondern Ausdruck dafür, dass die Vorgaben als grundsätzlich erfüllbar angesehen werden, auch wenn dafür erhebliche zusätzliche Ressourcen nötig sind. Um diesen Anforderungen gerecht zu werden, hat der Bund den Ländern Mittel in Höhe von 500 Millionen Euro bereitgestellt. Diese sollen die Kommunen bei der Datenerhebung, der Erstellung von Konzepten und der praktischen Umsetzung der Planungen entlasten.
Die Wärmeplanung gilt als Schlüssel, um die Dekarbonisierung des Gebäudesektors voranzubringen. Kommunen sollen in ihren Plänen aufzeigen, wie künftig eine klimafreundliche, sichere und bezahlbare Wärmeversorgung gewährleistet werden kann. Dabei geht es um die Bestandsaufnahme bestehender Infrastrukturen, die Erschließung von Potenzialen für erneuerbare Energien und die Integration neuer Technologien.
Ob die bereitgestellten Mittel und die aktuelle Gesetzeslage ausreichen, um die Ziele flächendeckend erreichbar zu machen, bleibt abzuwarten. Klar ist jedoch, dass die kommunale Wärmeplanung ein zentrales Element der Energiewende darstellt und Bund wie Länder in der Verantwortung sind, die Kommunen bei dieser Aufgabe nachhaltig zu unterstützen.
Quelle:
Verband der Immobilienverwalter Deutschland e. V. (VDIV Deutschland)
Leipziger Platz 9
10117 Berlin
T 030 300 96 79-0
office@vdiv.de
www.vdiv.de