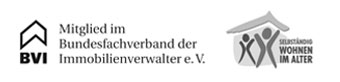Eine aktuelle Untersuchung von Sirius Campus beleuchtet die Perspektive der Energieberater zur Energiewende und zum Gebäudeenergiegesetz (GEG). Das Ergebnis: 56 Prozent der befragten Energieberater bewerten das GEG positiv, darunter besonders die Vollzeit-Energieberater und die „Optimisten der Energiewende“ (wie sie die Studie nennt).
Gleichzeitig zeigt sich aber auch: Viele Berater wünschen sich mehr Vereinfachung und klarere Strukturen im Gesetzestext. Vor allem der § 71 GEG mit den detaillierten Anforderungen an Heizungsanlagen wird teils als zu komplex wahrgenommen. 31 Prozent wünschen eine leichte, 18 Prozent eine deutliche Reduktion der Anforderungen für neue Heizsysteme.
Besonders wichtig erscheint die Kontinuität der Förderpolitik, um Planungssicherheit zu bieten. Mehr Flexibilität, Technologieoffenheit und gezielte Förderung einzelner Gewerke – etwa bei der Gebäudehülle – stehen ebenfalls weit oben auf der Wunschliste.
Die Untersuchung zeigt auch: Trotz eines gefühlten Nachfragerückgangs bei Beratungsaufträgen bleibt die Motivation der Berater hoch. Knapp zwei Drittel der Befragten wollen ihre Tätigkeit ausbauen; 13 Prozent planen sogar Neueinstellungen. Dass die Nachfrage pro Berater gesunken ist, liegt laut Sirius Campus vor allem an der stark gestiegenen Zahl der Energieberater – von rund 13.000 in 2023 auf rund 20.000 Ende 2024.
Die Zusammenarbeit mit Fördergebern wie BAFA und KfW wird mittlerweile besser bewertet als im Vorjahr. Vor allem beim BAFA sorgt eine schnellere Bearbeitung für bessere Urteile. Verbesserungsbedarf sehen die Berater allerdings noch bei Erreichbarkeit und Ansprechpartnern.
Für Immobilienverwaltungen ergeben sich aus der Untersuchung klare Impulse: Planungssicherheit, verständliche Vorgaben und eine gut steuerbare Förderlandschaft sind entscheidend, um Eigentümer zu Sanierungen zu motivieren und Projekte erfolgreich umzusetzen. Angesichts eines von den Energieberatern eingeschätzten durchschnittlichen Investitionsvolumens von 84.000 Euro pro Sanierungsprojekt im privaten Wohngebäude bleibt das Thema für die Branche hochrelevant.
Quelle:
Verband der Immobilienverwalter Deutschland e. V. (VDIV Deutschland)
Leipziger Platz 9
10117 Berlin
T 030 300 96 79-0
office@vdiv.de
www.vdiv.de