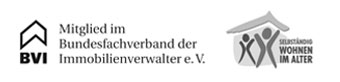Für die Untersuchung wertete Techem Daten aus rund 100.000 Mehrfamilienhäusern mit über einer Million Wohnungen aus. Seit 2021 sind die auf den Quadratmeter umgerechneten Heizkosten um rund 40 Prozent gestiegen, obwohl weniger geheizt wurde. Besonders teuer war das Heizen 2024 in Chemnitz (19,01 Euro/m²), Potsdam (18,61 Euro/m²) und im Saarland (15,75 Euro/m²).
Nach wie vor wird die große Mehrheit der Gebäude (87 Prozent) mit fossilen Energieträgern beheizt. Der Anteil sank damit nur leicht gegenüber dem Vorjahr (90 Prozent). Gleichzeitig holt die Fernwärme auf: Sie verursacht laut Techem weniger CO₂ pro Kilowattstunde als Erdgas und bleibt damit unter den CO₂-Zwischenzielen für 2030. Auch Holz und Strom – dieser insbesondere durch Wärmepumpen – schneiden in der Klimabilanz deutlich besser ab. Allerdings ist Fernwärme bislang die teuerste Heizform.
Die Auswertung bestätigt: Der Preis bestimmt nicht länger den Verbrauch. Bis etwa 2020 galt, dass ein Preisanstieg von vier Prozent zu einem Verbrauchsrückgang von einem Prozent führte. Diese Regel greift nicht mehr. 2024 stieg der witterungsbereinigte Verbrauch trotz höherer Preise leicht an. Das zeigt, dass einfache Sparmaßnahmen, wie das Herunterdrehen von Thermostaten oder kürzeres Lüften, weitgehend ausgereizt sind.
Für die Klimaziele im Gebäudesektor bedeutet das: Ohne technologische Innovationen wird der Fortschritt stagnieren. Techem sieht die größten Potenziale in digital steuerbaren Heizsystemen, Wärmepumpen und der Nutzung von Abwärme. Nach Unternehmensangaben eignen sich rund 90 Prozent der Mehrfamilienhäuser bereits heute für eine Umrüstung auf Wärmepumpen – oft mit nur geringen baulichen Anpassungen.
Trotz der Belastung durch hohe Kosten zeigt der Bericht auch positive Trends: Die CO₂-Emissionen pro Wohnung liegen mit durchschnittlich 1,5 Tonnen bereits unter dem Zwischenziel des Klimaschutzgesetzes. Damit trägt der Gebäudesektor stärker zur Erreichung der Klimaziele bei als erwartet, allerdings vorerst ohne großen Spielraum für weiteres individuelles Sparen.
Quelle:
Verband der Immobilienverwalter Deutschland e. V. (VDIV Deutschland)
Leipziger Platz 9
10117 Berlin
T 030 300 96 79-0
office@vdiv.de
www.vdiv.de