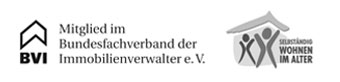Mit Urteil vom 18.07.2025 zum Aktenzeichen V ZR 76/24 entschied der BGH nicht nur, dass eine hinreichende Tatsachengrundlage (Entscheidungsgrundlage) auch durch ein einziges Angebot gewährleistet sein kann, sondern darüber hinaus, dass es im Ermessen der Wohnungseigentümer liegt, im Rahmen ordnungsmäßiger Verwaltung eine vom Verwalter ohne vorherigen Beschluss veranlasste Anwalts- der Gutachterbeauftragung nachträglich zu genehmigen, und zwar jedenfalls dann, wenn die beauftragte Maßnahme selbst ordnungsmäßiger Verwaltung entsprach.
Der Fall
Die Klägerin ist Bauträgerin und Mitglied der beklagten GdWE. Coronabedingt fand 2020 keine Eigentümerversammlung statt. Vor dem Hintergrund der im Oktober 2021 drohenden Verjährung von Mängelansprüchen aus den Bauträgerverträgen beauftragte der Verwalter im Frühjahr 2021 drei Sachverständige im Namen der GdWE mit einer Bestandsaufnahme zur Mängelfeststellung. Die Begutachtung ergab einen Mängelbeseitigungsaufwand von knapp 470.000 EUR. Die Gutachter berechneten knapp 50.000 EUR Honorar. Der Verwalter beauftragte im Namen der GdWE eine Rechtsanwaltskanzlei. Beschlussfassungen gingen diesen vier Vertragsschlüssen nicht voraus. (Erst) In einer Versammlung im Juli 2021 wurde mehrheitlich beschlossen, die erteilten Aufträge und bisherigen Kosten nachträglich zu genehmigen (TOP 6), die Rechtsanwaltskanzlei mit der außergerichtlichen und notfalls gerichtlichen Geltendmachung eines Kostenvorschusses zur Beseitigung der gutachterlich festgestellten Mängel zu beauftragen (TOP 7d) und hierzu mit der Kanzlei eine Vergütungsvereinbarung abzuschließen, deren Stundensätze 300,00 EUR netto je Anwaltsstunde und 150,00 EUR netto je Sekretariatsstunde nicht überschreiten dürfen (TOP 8). Das Amtsgericht München wies die Anfechtungsklage ab, das Landgericht München I gab ihr in der Berufungsinstanz statt. Die Nichtzulassungsbeschwerde und Revision der GdWE waren erfolgreich. Der BGH hält die Beschlüsse für rechtens.
Die Entscheidung
Der BGH sieht die Grundsätze einer ordnungsmäßigen Verwaltung durch die hier eingeschlagene Vorgehensweise gewahrt. Dahinstehen konnte, ob der Verwalter die Aufträge ohne vorherigen Beschluss erteilen durfte. Jedenfalls sei die GdWE berechtigt gewesen, die erteilten Aufträge nachträglich zu genehmigen, da sie angesichts der erkennbaren Mängel und drohenden Verjährung ordnungsmäßig waren. Zwar sei es richtig, dass die Bestandskraft der Genehmigungsbeschlüsse eine Art Entlastungswirkung („Einzelfallabsolution“) zugunsten des Verwalters darstellen, was in dem vorliegenden Fall aber unbedenklich gewesen sei. Die Klägerin (Bauträgerin) habe nicht darlegen können, dass Begutachtung und Rechtsverfolgung erkennbar unnötig oder die Gutachter und Rechtsanwaltskanzlei personell oder fachlich untauglich gewesen seien.
Der in der amts- und der landgerichtlichen Rechtsprechung sowie in Teilen des Schrifttums vertretenen Ansicht, vor jedweder Verwaltungsmaßnahme, die nicht nur unerhebliche finanzielle Aufwendungen erfordere, sei die Einholung von – zumeist drei – Vergleichsangeboten erforderlich, um für eine Entscheidungsgrundlage zu sorgen, erteilt der BGH eine Absage. Der BGH betont, dass aus seiner Rechtsprechung eine allgemeine Pflicht zur Einholung von Alternativangeboten nicht hervorgehe. Speziell bei der Beauftragung eines Rechtsanwalts sie dies nicht erforderlich, weil Stundensatz und Zeitkontingent den Wohnungseigentümern die Stärken und Schwächen der Leistungsangebote ohnehin nicht aufzeigen können.
Fazit für den Verwalter
„Wer nicht wagt, der nicht gewinnt“ – so mag man dem Verwalter im vorliegenden Fall zurufen. Unzweifelhaft konnte der Verwalter Sachverständigenvertrag und Rechtsanwaltsvertrag namens der GdWE wirksam schließen und die GdWE binden. Seine gesetzliche Vertretungsmacht aus § 9b WEG deckt das. Angesichts der Gutachterkosten von 50.000 EUR und sicherlich – der Sachverhalt lässt die Höhe nicht erkennen – nicht unbeträchtlicher Rechtsanwaltskosten durfte er das ohne Beschluss aber nicht, da die Voraussetzungen von § 27 Abs. 1 WEG nicht vorlagen. Die Ausgaben lagen erkennbar über 2% – 5% des Gesamtbudgets des laufenden Wirtschaftsplanes und auch von 3.000 – 5.000 EUR, wie sie von manchen Gerichten und Autoren als pauschale „Bagatell-Obergrenze“ gezogen werden. Eine höchstrichterliche Klärung der umstrittenen Rechtslage steht nach wie vor aus.
Obwohl die Verträge wirksam geschlossen waren, durften die Wohnungseigentümer sie nachträglich genehmigen. Das schafft einerseits Rechtssicherheit und Rechtsklarheit innerhalb der GdWE, kann aber auch „Regressgelüste“ einzelner Wohnungseigentümer gegen GdWE und den Verwalter im Keim ersticken. Dies gilt jedenfalls dann, wenn – wie hier – die Vorgehensweise angesichts der Anhaltspunkte für verschiedene Baumängel ordnungsmäßig erschienen. Dadurch, dass Rechtsanwalt und Gutachter bereits auf Basis wirksamer Mandate bzw. Verträge mit der Angelegenheit befasst waren und ihre vertraglichen Verpflichtungen gegenüber der GdWE ordnungsmäßig erfüllten, wäre es reine Förmelei, wenn man vom Verwalter für die nachträgliche Genehmigung die Einholung von Alternativangeboten fordern wollte. Die Situation ist nach Sinn und Zweck nicht anders als bei der Beauftragung eines Folgeauftrages mit gleichem Leistungsbild an denselben, bereits erfolgreich bzw. beanstandungslos tätigen Auftragnehmer der GdWE – hier verlangt die ganz herrschende Meinung keine Vergleichsangebote. Berücksichtigt man außerdem, dass die Mehrheit unter 3 Anbietern ohnehin den bereits tätigen Rechtsanwalt oder Sachverständigen „genehmigen“ dürfen, würde die Forderung nach 2 weiteren Angeboten evident zur Farce werden.
Der Verwalter darf gemäß § 27 Abs. 2 WEG Delegationsbeschlüsse für die Beauftragung von Rechtsanwälten oder Privatgutachtern (Bausachverständigen etc.) auf Basis von Honorarvereinbarungen herbeiführen. In Bezug auf die Passivvertretung der GdWE gegenüber Beschlussklagen verweisen wir auf unsere Newsletter vom 17.09.2021 (mit Musterbeschluss) und 16.10.2023 zu einem Urteil des Landgerichts Karlsruhe, das durch die BGH-Entscheidung hinfällig sein dürfte.
Fazit für Wohnungseigentümer oder Verwaltungsbeiräte
Nicht nur Verwalter, sondern auch Wohnungseigentümer sind aufgerufen, Vergleichsangebote einzuholen, wenn er der Auffassung ist, die Beschlussfassung im Hinblick auf ein ausgewogenes Preis-Leistungs-Verhältnis verbessern zu können. Wohnungseigentümer haben bei der Beschlussfassung über Verwaltungsmaßnahmen, zu denen auch Vertragsabschlüsse jeder Art gehören, einen weiten Ermessensspielraum. Zwar müssen sie das Gebot der Wirtschaftlichkeit beachten und im Grundsatz auch die Leistungsfähigkeit der Wohnungseigentümer. Gleichwohl eröffnet sich der Mehrheit ein weiter Gestaltungs- und Beurteilungsspielraum. Die Mehrheit ist berechtigt, Kosten und Nutzen bzw. Preis und Gegenleistung gegenüberzustellen und sich am Ende beispielsweise für das teuerste Angebot zu entscheiden.
Die Klägerin ist Bauträgerin und Wohnungseigentümerin. Bei der Abstimmung über die Rechtsverfolgung ihr gegenüber war sie vom Stimmrecht ausgeschlossen (§ 25 Abs. 4) Variante 2 WEG). Inwieweit dies auch für vorbereitende oder begleitende Maßnahmen gilt, etwa die Beauftragung einer gutachterlichen Bestandsaufnahme und die Finanzierung von Gutachten und Prozessführung ist eine höchstrichterlich noch nicht geklärte Frage. Die GdWE ist zwar nicht Partei der Bauträgerverträge, nach dem Gesetz aber für die Verfolgung von Mängelansprüchen aus den individuellen Verträgen zuständig.
Fazit für die Gemeinschaft
Im gerichtlichen Verfahren dürfen die gesetzlichen Rechtsanwaltsgebühren durch eine Vergütungsvereinbarung nicht unterschritten werden. Es gelten berufsrechtliche und wettbewerbsrechtliche Verbote. Im außergerichtlichen Bereich gibt es Spielraum. In der Praxis ist der Abschluss von Vergütungsvereinbarungen weit verbreitet mit Stundensätzen, die sich oft zwischen 200 EUR bis 400 EUR pro Stunde netto zzgl. gesetzlicher Umsatzsteuer bewegen. Im Fall beurteilte der BGH die Billigung der Höhe des Anwaltshonorars in Anbetracht der besonderen Gesamtumstände als ermessensfehlerfrei. Nicht nur der „Verjährungsdruck“, sondern auch das spezielle Rechtsgebiet (WEG-Recht verknüpft mit Baurecht) werden als Argumente angeführt (Rn. 29 der Urteilsgründe), und auch die Aufspaltung in Anwalts- und Sekretariatsstunde hält der BGH für vertretbar (Rn. 30).
Eine Vereinbarung über die Anwaltsvergütung bedarf der Textform. Sie muss als Vergütungsvereinbarung oder in vergleichbarer Weise bezeichnet werden, von anderen Vereinbarungen (z.B. Haftungsbeschränkung) mit Ausnahme der Auftragserteilung deutlich abgesetzt sein und darf nicht in der Vollmacht enthalten sein (§ 3a Abs. 1 Rechtsanwaltsvergütungsgesetz – RVG). Vor unangemessen hohen Vergütungsvereinbarungen ist der Mandant durch § 3a Abs. 3 Satz 1 RVG geschützt, wonach die Vergütung im Streitfall bis auf die gesetzliche Vergütung herabgesetzt werden darf. Im amtlichen Leitsatz spricht der BGH von „Honorarvereinbarung“. Dies ist der Oberbegriff für Vergütungs- und Gebührenvereinbarungen (§ 34 RVG). Letztere betreffen nicht die Vertretung nach außen, sondern eine Beratung im Innenverhältnis ohne Vertretung.
Was der BGH hier für Rechtsanwälte und Gutachter entschieden hat, dürfte entsprechend gelten für vergleichbare Auftragnehmer, wie z.B. Architekten, Ingenieure oder sonstige Fachplaner.
Quelle:
Verband der Immobilienverwalter Deutschland e. V. (VDIV Deutschland)
Leipziger Platz 9
10117 Berlin
T 030 300 96 79-0
office@vdiv.de
www.vdiv.de